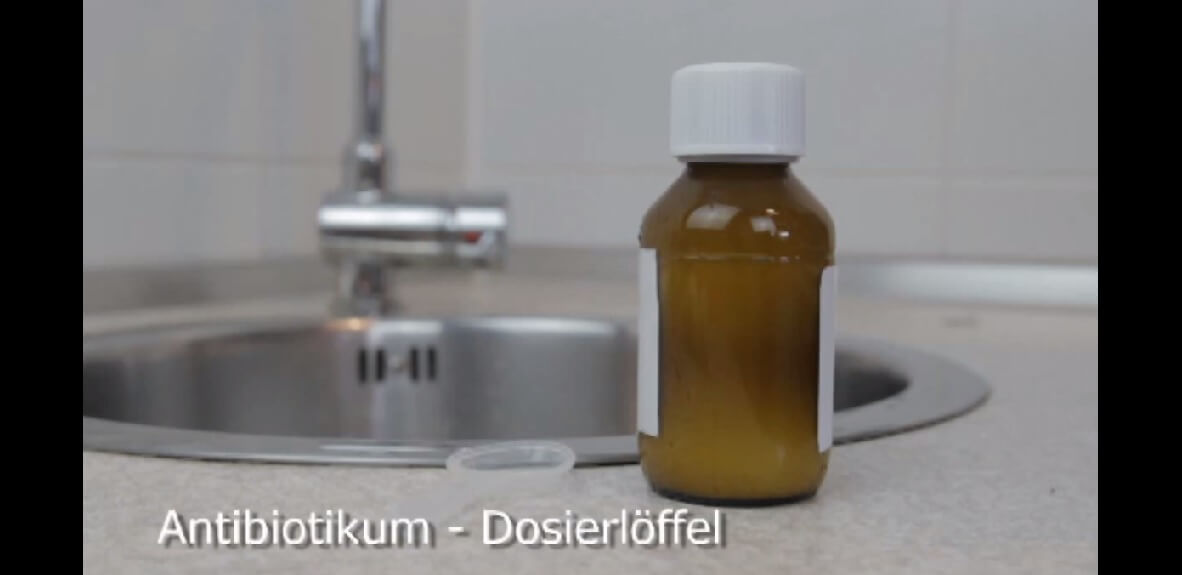Ratgeber

Der Fibromyalgie Einhalt gebieten
Schmerzen lindern, Schlaf verbessern-
Komplexe eigenständige Erkrankung
Das Fibromyalgie-Syndrom (oder einfacher, die Fibromyalgie) ist eine chronische Erkrankung, die durch diffuse, generalisierte Muskelschmerzen in verschiedenen Körperregionen gekennzeichnet ist. Das wird auch durch den lateinischen Namen ausgedrückt, der wörtlich übersetzt „Faser-Muskel-Schmerz“ bedeutet. Zusätzlich leiden die Betroffenen unter Schlafstörungen, Müdigkeit und ausgeprägter Erschöpfung. Auch vegetative Beschwerden wie Verdauungsstörungen oder vermehrtes Schwitzen werden beobachtet.
Besonders an diesem Schmerzsyndrom ist, dass sich keine organischen Schäden nachweisen lassen. Deshalb wurden Patient*innen mit Fibromyalgie lange Zeit nicht ernst genommen und die Beschwerden als psychosomatisch abgetan. 1990 definierten Fachgesellschaften die ersten Kriterien für die Erkrankung. Trotzdem zweifelten einige Kritiker*innen immer noch am Bestehen dieser Krankheit. Neuere Forschungen haben aber erbracht, dass es sich bei der Fibromyalgie tatsächlich um eine „echte“ eigenständige Krankheit handelt.
Bisher wurde die Fibromyalgie aufgrund ihrer Muskel-Sehnenschmerzen oft als rheumatische Erkrankung angesehen. Diese Einordnung greift neueren Kenntnissen zufolge jedoch zu kurz, denn das Syndrom ist deutlich komplexer. Schmerzexpert*innen ordnen das Fibromyalgie-Syndrom inzwischen dem noziplastischen Schmerz zu. Dieser Schmerz betrifft das gesamte Nervensystem und entsteht dadurch, dass die Schmerzverarbeitung gestört ist.
Die Ursache ist multifaktoriell – vermutlich spielen u. a. genetische Faktoren und psychosoziale Belastungen eine Rolle. Als Letztere werden z. B. Gewalterfahrungen in der Kindheit und im Erwachsenenalter, frühe negative Schmerzerfahrungen und andauernde kritische Lebensereignisse diskutiert.
Hinweis: Das Unwissen über das Fibromyalgie-Syndrom führte in der Vergangenheit zu vielen Fehldiagnosen. Betroffene – meist Frauen – wurden als hysterisch oder depressiv bezeichnet, manchmal galt auch die Menopause als Auslöser. Oft unterstellte man den Erkrankten sogar, sie würden die Schmerzen nur simulieren. Wie man heute weiß, trifft davon nichts zu.
Wie macht sich die Fibromyalgie bemerkbar?
Kennzeichnend für eine Fibromyalgie sind die über den Körper weit ausgedehnten Schmerzen sowie Muskelverspannungen und Muskelsteifigkeit. Sowohl die Stärke als auch die Art der Schmerzen variieren häufig. Das Ausmaß reicht von leicht bis unerträglich, empfunden werden die Schmerzen als brennend, schneidend, dumpf oder bohrend.
Auch die betroffenen Bereiche können wechseln. Sehr häufig werden Schmerzen am Rücken und an den Armen beschrieben, die sich wie Muskelkater anfühlen. Die Muskeln und die Muskel-Sehnenansätze sind oft druckschmerzhaft. Früher galten bestimmte Druckschmerzpunkte (sogenannte Tenderpoints) als beweisend für eine Fibromyalgie. Inzwischen weiß man aber, dass diese Tenderpoints nicht zwingend vorhanden sein müssen.
Neben den Schmerzen leiden Fibromyalgie-Patient*innen auch unter zahlreichen anderen Beschwerden. Bei fast allen ist der Schlaf gestört, als Folge kommt es zu einer ausgeprägten Tagesmüdigkeit. Viele Betroffene fühlen sich körperlich stark erschöpft bis hin zur Fatigue. Das vegetative Nervensystem ist ebenfalls oft beteiligt. Viele Kranke sind kälteempfindlicher oder schwitzen vermehrt, andere haben Missempfindungen und leiden unter Kribbeln. Magen-Darm-Störungen und Atembeschwerden kommen ebenfalls vor. Insgesamt werden bis zu 150 Symptome beschrieben, die mit einem Fibromyalgie-Syndrom einhergehen können.
Durch die starke Belastung entwickeln manche Betroffene auch seelische Beschwerden. So werden Konzentrationsschwierigkeiten (der sogenannte Fibro-Fog), aber auch Ängstlichkeit und Stimmungsschwankungen beklagt. In ausgeprägten Fällen kommt es sogar zu starken Depressionen. Ganz wichtig ist dabei: Diese Veränderungen sind nicht die Ursache der Erkrankung, sondern eine Folge der ständigen Schmerzen und Erschöpfung.
Hinweis: In Deutschland sind etwa 2% aller Erwachsenen von einer Fibromyalgie betroffen. Meist macht sich die Erkrankung im Alter zwischen 40 und 60 Jahren bemerkbar, aber auch Kinder und alte Menschen können darunter leiden. Insgesamt haben Frauen häufiger eine Fibromyalgie als Männer.
Ist es eine Fibromyalgie?
Schmerzen und Erschöpfung sind unspezifische Beschwerden, die bei vielen Erkrankungen vorkommen. Ob es sich dabei um eine Fibromyalgie handelt, erkennt die Ärzt*in anhand der Krankengeschichte, der geschilderten Symptome und der körperlichen Untersuchung.
Im ausführlichen Gespräch fragt die Ärzt*in danach, wie lange die Beschwerden schon vorhanden sind, wie sie sich zeigen und welche Begleiterscheinungen auftreten. Das Ausmaß der Schmerzen und Einschränkungen erfasst man mit speziellen Frage- und Dokumentationsbögen.
Danach wird die Patient*in körperlich untersucht. Dabei erkennt die Ärzt*in druckschmerzhafte Bereiche und dokumentiert sie ebenso wie die Areale des Körpers, in denen die Patient*in die Schmerzen angegeben hat. Die nach den früheren Kriterien geforderten Tenderpoints können untersucht werden, gelten aber nur noch als unterstützend für eine Diagnose. Entscheidend sind Ausdehnung und Stärke der Schmerzen. Zur Messung der Ausdehnung verwendet man den Widespread Pain Index (WPI), zur Messung der Stärke die Symptom Severity Scale (SSS).
Um wichtige Differenzialdiagnosen auszuschließen, führt die Ärzt*in je nach individuellem Fall verschiedene orthopädisch-neurologische Untersuchungen durch. Dazu gehören u.a. Beweglichkeitsprüfungen von Wirbelsäule und Gelenken sowie die Testung von Kraft und Sensibilität. Auch das Abfragen der eingenommenen Medikamente ist wichtig, denn einige Wirkstoffe können Muskelbeschwerden verursachen (z. B. Statine oder bestimmte Antibiotika).
Nach diesen Untersuchungen lässt sich meist erkennen, ob die heute geforderten Kriterien für die Diagnose einer Fibromyalgie vorliegen. Diese sind
- konstante Beschwerden über drei Monate oder mehr
- generalisierte Schmerzen in mindestens vier von fünf Körperregionen (Hand-Arm-Schulter rechts bzw. links, Fuß-Bein-Hüfte rechts bzw. links, Kopf/Hals/Rumpf)
- Ausdehnung und Ausmaß der Beschwerden, WPI ≥ 7 und ein SSS ≥5 oder ein WPI 4-6 und ein SSS ≥9
Einen bestimmten Laborwert, der die Fibromyalgie anzeigt, gibt es bisher nicht. Zwar wurden bei einigen Betroffenen erniedrigte Werte des Botenstoffs Serotonin, bei anderen erhöhte Werte der Substanz P gefunden – für eine Diagnose sind diese Werte bisher aber nicht geeignet. Trotzdem werden meist Laboruntersuchungen angeordnet. Damit lassen sich Erkrankungen ausschließen, die ähnliche Beschwerden wie eine Fibromyalgie auslösen können. Dazu gehören z. B. rheumatische oder Muskelerkrankungen, die Lyme-Arthritis oder eine Schilddrüsenunterfunktion.
Hinweis: Menschen mit Fibromyalgie haben oft einen langen Ärzt*innen-Marathon hinter sich, bis die Diagnose gestellt wird. Prinzipiell ist zunächst die Hausärzt*in die erste Anlaufstation für die Abklärung, im Zweifel kann man von dort zu einer Fachärzt*in überwiesen werden. Zur Weiterbehandlung bei bestehender Diagnose eignen sich Schmerzspezialist*innen, es gibt auch Spezialkliniken mit Fibromyalgie-Ambulanzen.
Bewegung ist das A und O
Die Fibromyalgie ist ein chronisches Schmerzsyndrom, das nicht geheilt, wohl aber gelindert werden kann. Es ist wichtig, dass Patient*in und Ärzt*in gemeinsam ein Therapieziel erarbeiten und die Behandlung darauf ausrichten. Ein realistisches Ziel ist zum Beispiel, Schmerzen, Müdigkeit und Schlafstörungen um mindestens 30 % zu reduzieren.
Basis der Behandlung ist die Psychoedukation inklusive einer ausführlichen Aufklärung über die Erkrankung. Die Patient*in lernt dabei, dass die Fibromyalgie nicht lebensbedrohlich ist und sich die Beschwerden durch eigene Aktivität lindern lassen.
Die Therapie erfolgt nach dem Schweregrad der Erkrankung. Bei leichterer Ausprägung reichen oft eine diszipliniert durchgeführte Bewegungstherapie und die Förderung sozialer und geistiger Aktivitäten. In schweren Fällen kommen Medikamente hinzu.
- Bewegungstherapie. Körperliche Bewegung hat eine Schlüsselrolle bei der Behandlung. Es ist zweifelsfrei nachgewiesen, dass regelmäßiges Training fast alle Fibromyalgiebeschwerden nachhaltig bessert. Ein Programm mit drei Trainingseinheiten von 30 bis 60 Minuten pro Woche steigert die Lebensqualität und senkt die Schmerzen. Zum Ausdauertraining eignen sich schnelles Spazierengehen, Tanzen, Radfahren oder Aquajogging. Empfohlen werden je 2-3 Mal pro Woche über 30 Minuten. Zusätzlich sind Wasser- und Trockengymnastik mit Flexibilitäts- und Kräftigungsübungen günstig. Als effektiv hat sich auch Zumba erwiesen – entscheidend ist, dass die Betroffenen in Bewegung kommen und bleiben.
- Soziale Aktivitäten. Oft führt die Fibromyalgie zu so starker Erschöpfung, dass die Betroffenen Aktivitäten lieber meiden und sich zu Hause ausruhen. Doch gerade regelmäßige soziale Kontakte, Freizeitunternehmungen und Hobbys bessern die Lebensqualität und helfen, Stress und Depressionen zu reduzieren.
- Physiotherapie. Ob Osteopathie, manuelle Therapie oder spezielle Massagen grundlegend hilfreich sind, wird kontrovers diskutiert. Akute Schmerzen lassen sich aber Studien zufolge durchaus von erfahrenen Therapeut*innen mittels Druck-Massage-Manipulationen lindern.
- Physikalische Therapie: Vibrationstraining, Wärme- oder Kälteanwendungen und Hydrotherapie werden von vielen Betroffenen als lindernd empfunden und können individuell ausprobiert werden. Nachteil ist allerdings, dass diese Behandlungen meist selbst bezahlt werden müssen. Bei Wärmebehandlungen ist außerdem zu beachten, dass die überempfindlichen Körperbereiche durch zu große Wärme überreizt werden können. Sowohl Sauna als auch Infrarotkabinen oder Einreibungen mit wärmenden Salben sollten deshalb mit Vorsicht genossen werden.
- Psychotherapie. Wenn die Betroffenen die Krankheit psychisch nicht bewältigen oder psychische Begleitstörungen vorliegen, sind v. a. psychotherapeutische Verfahren eine Option. Es kommen insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback infrage. Viele Betroffene empfinden auch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion und Entspannungsverfahren als hilfreich.
Medikamente zur Behandlung der Fibromyalgie
Etwa 30 bis 40 % der Betroffenen sprechen nicht ausreichend auf die nicht-medikamentöse Therapie an. Sie benötigen gegen ihre Schmerzen und Beschwerden Medikamente. Allerdings ist in Deutschland kein Wirkstoff explizit zur Behandlung der Fibromyalgie zugelassen, ihr Einsatz erfolgt also „off label“. Prinzipiell gilt dabei, dass Medikamente nur zeitlich befristet und nur im Rahmen eines Gesamttherapiekonzepts eingesetzt werden sollen.
Verwendet werden dabei verschiedene Substanzgruppen. Dazu gehören Antidepressiva und Antikonvulsiva. Letztere sind Wirkstoffe, die gegen epileptische Anfälle entwickelt wurden und übermäßige Nervenzellaktivitäten hemmen. In Ausnahmefällen kommen auch schwache Opioide in Frage. Welche davon verordnet werden, entscheidet die Ärzt*in aufgrund der Schmerzintensität und der begleitenden Beschwerden.
- Am häufigsten bei Fibromyalgie verwendet wird das Antidepressivum Amitriptylin. Es dämpft die Schmerzwahrnehmung im Gehirn, indem es die Wiederaufnahme der Botenstoffe Noradrenalin und Serotonin hemmt. Durch einen weiteren Wirkmechanismus verbessert es zusätzlich den Schlaf. Nebenwirkungen sind u.a. Mundtrockenheit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen und Gewichtszunahme. Liegt neben der Fibromyalgie eine Depression vor, verordnen die Ärzt*innen oft das Antidepressivum Duloxetin. Es wirkt ähnlich wie Amitryptilin und bessert dadurch Schmerz, Schlaf und die Stimmung.
- Auch das Antikonvulsivum Pregabalin hat einen Einfluss auf die zentrale Schmerzverarbeitung. Es dämpft u. a. die hypersensiblen Schmerzwege. Durch die Stabilisierung der Nervenzellen bessern sich Schmerzen, Schlaf und Erschöpfung bei den Betroffenen. Es ist eine gute Option, wenn die Betroffenen begleitend unter einer Angststörung leiden. Als Nebenwirkung kann es zu Gewichtszunahme und Wassereinlagerung in den Beinen kommen.
- Bei sehr schweren, therapieresistenten Schmerzanfällen kann das schwache Opioid Tramadol als akutes „Rettungsmittel“ helfen. Aufgrund des Abhängigkeitsrisikos darf es aber nur kurzfristig eingenommen werden.
Viele Schmerzmittel sind bei der Fibromyalgie unwirksam oder haben ein zu ausgeprägtes Nebenwirkungsrisiko und werden daher nicht empfohlen. Dazu gehören nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und Paracetamol, aber auch starke Opioide, Schlafmittel und muskelentspannende Substanzen. Ob Cannabinoide helfen, wird noch diskutiert. In einer aktuellen Studie besserte THC-reiches Cannabisöl bei den untersuchten Patient*innen Schmerz und Fatigue.
Leben mit Fibromyalgie
Die Fibromyalgie ist keine lebensbedrohliche Erkrankung. Weil dabei keine Organe geschädigt werden, beeinflusst die Erkrankung selbst auch die Lebenserwartung nicht. Trotzdem leiden viele Fibromyalgie-Patient*innen unter einer stark eingeschränkten Lebensqualität. Daran sind nicht nur die Schmerzen Schuld. Dauermüdigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsschwierigkeiten können Alltag und Beruf erschweren und ein normales Leben fast unmöglich machen.
Oft ist es für die Betroffenen schwierig, anderen ihre Schmerzen und ihre Erschöpfung zu vermitteln. Denn Menschen, die nicht darunter leiden, können sich das Ausmaß der Beschwerden oft nicht vorstellen und verstehen die Erkrankung nicht. Deshalb sind gerade für Fibromyalgie-Patientinnen Selbsthilfegruppen so wichtig. Beim Austausch mit Leidensgenoss*innen können Probleme besprochen und Lösungswege diskutiert werden. Oft unterstützen Selbsthilfegruppen auch dabei, therapeutisch am Ball zu bleiben. Denn um der Fibromyalgie mit mehr Bewegung und einem aktiven Lebensstil effektiv zu begegnen, sind Ausdauer und Disziplin nötig. Fibro-Fog und Erschöpfung machen es aber häufig schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Mitbetroffene und Selbsthilfegruppen können bei diesem Dauerkampf gegen die Erkrankung helfen. Selbsthilfegruppen findet man auf den Webseiten der Deutschen Fibromyalgie Vereinigung (DFV) oder bei der Fibromyalgie-Liga Deutschland.
Auch die Deutsche Schmerz-Liga bietet Links zu Selbsthilfegruppen sowie eine zentrale Hotline an. Eine besonders gute Sache sind auch Patientenschulungen. So hat z. B. die Rheuma-Liga gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie ein Schulungsprogramm für Betroffene entwickelt. In Kleingruppen werden die Patient*innen in mehreren Sitzungen über Therapiemöglichkeiten informiert. Wenn der Kurs ärztlich verordnet wird, übernehmen die Krankenkassen häufig die Kosten.
Quellen: DGS-Praxisleitlinie Fibromyalgie-Syndrom, Deutsche Schmerzgesellschaft e. V.
weiterlesen weniger

Diese Impfungen müssen sein
Kindergesundheit im Blick-
Schon über 150 Millionen Leben gerettet
Impfungen und Impfstoffe gehören zu den wichtigsten Errungenschaften der Medizin. Durch sie wurden allein in den letzten 50 Jahren 154 Millionen Leben gerettet und die globale Lebenserwartung deutlich gesteigert. Die erste Impfung war die Ende des 18. Jahrhunderts eingeführte Pockenimpfung. Im 19. Jahrhundert kamen Impfstoffe gegen Tetanus und Milzbrand dazu, und inzwischen schützen Impfstoffe gegen mehr als 30 schwere oder folgenreiche Infektionen.
Die Ergebnisse der Impfmedizin können sich sehen lassen. So gelten die Pocken inzwischen als ausgerottet, und die Kinderlähmung steht mit jährlich etwa 100 Fällen weltweit kurz davor. Diphtherie und Keuchhusten sind in industrialisierten Ländern fast verschwunden, und neueste Impfungen wie gegen HPV können sogar die Entwicklung von Krebs verhindern.
Impfungen dienen vor allem dem Schutz von Kindern. Ihr Immunsystem ist noch unreif, was sie anfälliger für ansteckende Krankheiten macht. Das bedeutet aber nicht nur, dass sie leichter infiziert werden. Kommt es zu einer Infektion, verläuft die Erkrankung bei ihnen oft besonders schwer. So können Masern, Keuchhusten und Rotavirus-Infektionen bei Säuglingen und Kleinkindern bleibende Schäden zurücklassen oder sogar tödlich sein. Diese Kinderkrankheiten sind also keinesfalls harmlos – auch wenn ihr Name das vielleicht nahelegt.
Mit rechtzeitigen Impfungen lassen sich viele gefährlichen Erkrankungen ganz verhindern oder zumindest schwere Verläufe abmildern. Denn Impfungen trainieren das Immunsystem, ohne die Krankheit auszulösen: Indem man harmlose Anteile eines Erregers verabreicht, lernen die Immunzellen, mit der Infektion umzugehen. Es werden dann nicht nur spezifische Antikörper zur Abwehr gegen den Erreger entwickelt. Das Immunsystem bildet auch sogenannte Gedächtniszellen, die sich die Abwehr merken. Kommt es nach der Impfung zum Kontakt mit dem echten Erreger, erkennen sie diesen schneller und können innerhalb kürzester Zeit die passenden Antikörper produzieren.
Impfungen nützen nicht nur dem geimpften Kind. Sie wirken auch indirekt schützend auf die gesamte Gemeinschaft – das nennt man Herdenschutz. Das liegt daran, dass geimpfte Kinder die Weitergabe von kursierenden Erregern vermindern. Sind über 95% gegen eine Erkrankung geimpft, bricht die Übertragungskette ab. Dadurch werden Ausbrüche eingedämmt und die Krankheitslast in Kitas und Schulen deutlich verringert.
Doch nicht nur andere Kinder profitieren von der Impfung. Durch die verringerte Weitergabe von Erregern schützt man auch Erwachsene vor einer Infektion. Besonders wichtig ist dies für diejenigen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. So z. B. alte Menschen, chronisch Kranke oder solche, die immununterdrückende Medikamente einnehmen.
Hinweis: Allein die Masernimpfung ist hocheffektiv, wie die WHO berechnet hat. Bis 2024 hat sie rund 58 Millionen Leben gerettet – und zwar vor allem das von Kindern.
Nur Impfen schützt
Damit Impfungen schützen können, gibt es nur eins: Impfen. Denn die Erreger sind (bis auf die Pocken) nicht verschwunden. Überall dort, wo sich Menschen aufhalten, sind auch Viren und Bakterien zu finden. Darunter tummeln sich nicht nur harmlose Erkältungsviren, sondern potenziell auch all die Erreger, die Kindern gefährlich werden können.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) ist ein unabhängiges Expert*innenteam, das die Wirkung und die Sicherheit von Impfungen wissenschaftlich prüft und Empfehlungen dazu herausgibt. Jedes Jahr wird ein Impfkalender veröffentlicht, indem diese Empfehlungen aktualisiert werden. Darin finden sich die Zeitpläne, wann Kinder, Jugendliche und Erwachsene gegen welche Erkrankung geimpft werden sollten.
Die meisten Eltern lassen ihre Kinder gemäß der STIKO-Empfehlungen impfen. Noch liegen die Impfquoten auf recht hohem Niveau. So sind über 90% der Säuglinge und Kleinkinder gegen Diphtherie, Polio und Tetanus geimpft. Allerdings werden inzwischen immer häufiger die nötigen Auffrischimpfungen unterlassen. Auch bei Impfungen, die erst für Jugendliche empfohlen werden, ist noch viel Luft nach oben. Die gegen Krebs schützende HPV-Impfung haben bei den 15-Jährigen 55% der Mädchen und 36% der Jungen erhalten.
Hinweis: Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in Deutschland alle von der STIKO empfohlenen Impfungen für Kinder und Jugendliche als Kassenleistung. Voraussetzung ist, dass diese in die Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) aufgenommen wurden.
Warum Eltern sich sorgen
Manche Eltern sorgen sich jedoch, dass eine Impfung ihrem Kind schaden könnte. Sie fürchten schwere Nebenwirkungen wie z. B. akute Herzmuskelentzündungen oder Langzeitfolgen. Solche Ängste werden von einigen Randgruppen geschürt, vor allem geschieht dies in sozialen Medien. So wurde die Masernimpfung angeschuldigt, Autismus auszulösen, der HPV-Impfung sagten Impfgegner*innen nach, sie führe zur Unfruchtbarkeit. Beides ist wissenschaftlich widerlegt und wird trotzdem immer wieder verbreitet. Auch die Impfdebatte um Corona hat die Skepsis bei einigen Menschen verstärkt. Deshalb ist es wichtig, sich unabhängige, neutrale Informationen zu besorgen. Gute Adressen dafür sind die STIKO und natürlich die Haus- oder Kinderärzt*in.
Ein häufig gehörtes Argument gegen Impfungen ist, dass Impfungen das Immunsystem der Kinder überlasten. Doch das kindliche Immunsystem ist unglaublich leistungsstark, es verarbeitet täglich tausende Antigene aus der Umwelt und der Nahrung. Die Standard-Sechsfachimpfung für Säuglinge nutzt nur etwa 0,1% dieser Immunkapazität. Impfungen stören auch die sonstige Abwehr nicht: Dass frisch geimpfte Kinder gleichzeitig nicht mehr Infektionen bekommen, haben zahlreiche Studien nachgewiesen.
Auch die Nebenwirkungen werden von Impfgegner*innen ins Feld geführt. Leichte Impfreaktionen wie Rötungen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen oder leichtes Fieber zeigen, dass der Körper auf die Impfung reagiert. Sie können bei allen von der STIKO empfohlenen Impfungen auftreten und sind in der Regel unbedenklich und nur von kurzer Dauer. Schwere Nebenwirkungen sind dagegen überaus selten. Forschende haben berechnet, dass es bei einer von 1 Million verabreichten Impfdosen zu einer Anaphylaxie (einer schweren Überempfindlichkeitsreaktion) kommt. Viel gefährlicher als Impfungen sind die entsprechenden Krankheiten: Masern führen in 30% der Fälle zu schweren Komplikationen wie Lungen- oder Gehirnentzündung. Und von 100-200 Polio-Infizierten behalten etwa ein bis zwei eine Lähmung der Beine zurück.
Hinweis: Impfstoffe werden nicht nur vor ihrer Zulassung umfassend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrer Sicherheit von den entsprechenden Behörden geprüft. Auch nach Einführung der Impfung werden sie weiter kontrolliert und jahrzehntelang Daten gesammelt und analysiert, um etwaige Langzeitprobleme zu erkennen.
Die einzelnen Impfungen im Kindesalter – das sollte man wissen
Welche Impfungen die STIKO im Einzelnen empfiehlt, richtet sich nach dem Lebensalter. Zur von der STIKO empfohlenen Grundimmunisierung gehören Impfungen gegen folgende Infektionen:
- Rotavirus-Infektion
- Tetanus
- Diphtherie
- Poliomyelitis
- Keuchhusten (Pertussis)
- Hämophilus-influenza-Infektion (Hib)
- Hepatitis B
- Pneumokokkeninfektion
- Meningokokkeninfektion
Im Alter von sechs Wochen geht es mit der Impfung gegen Rotaviren los, ab Woche acht kommen bis zu acht weitere Impfungen hinzu. In den meisten Fällen handelt es sich um Impfungen, die in drei Dosen verabreicht werden, z. B. im zweiten, im vierten und im elften (bis zwölften) Lebensmonat. Sie alle können an einem Tag gegeben werden. Als Sechsfach-Impfung in einer Spritze gibt es z. B. Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio (Kinderlähmung), Hib und Hepatitis B. Die Impfstoffe gegen Meningokokken B und Pneumokokken werden einzeln geimpft. Je nach Impfstoff sind weitere Auffrischimpfungen im sechsten Lebensjahr und im Alter von 9 bis 16 Jahren nötig.
- Rotaviren-Infektion. Rotaviren treten gehäuft zwischen Februar und April auf. Fast alle Säuglinge und Kleinkinder stecken sich damit an, insbesondere in den ersten zwei Lebensjahren. Pro Jahr erkranken etwa 40-60 000 Kinder daran. Die Erkrankung löst wässrigen Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen aus. Vor allem Säuglinge können viel Flüssigkeit und Mineralien verlieren und austrocknen, es kann sogar zu Todesfällen kommen. Bei der Impfung handelt es sich um eine Schluckimpfung, die je nach Präparat aus 2 bis 3 Dosen besteht. Die erste Dosis soll mit sechs Wochen verabreicht werden. Als Nebenwirkung ist die Darminvagination bekannt, bei der sich ein Teil des Darms in einen anderen hineinschiebt. Das natürliche Invaginationsrisiko bei Säuglingen beträgt 60 bis 100 auf 100 000 Kinder pro Jahr. Nach der ersten Dosis der Rotaviren-Impfung steigt das Risiko minimal an, und zwar auf 1 bis 5 zusätzliche Fälle pro 100 000 geimpften Säuglingen. Der Nutzen der Impfung überwiegt damit das Risiko erheblich, weshalb die Impfung auch von der STIKO empfohlen wird.
- Diphtherie wird durch Bakterien übertragen und führt zu Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Fieber und Heiserkeit. Früher sind viele Kinder an der Diphtherie erstickt, weltweit sterben heute etwa 5 bis 10% der Erkrankten an Herz- und Nierenschäden. In Deutschland kommt die Diphtherie kaum noch vor. In anderen Ländern ist die Erkrankung noch verbreitet, bei unvollständigem Impfschutz kann sie deshalb auch in Deutschland wieder Fuß fassen. Geimpft wird im Rahmen der Grundimmunisierung, meist mit dem sogenannten Sechsfachimpfstoff.
- Tetanus. Tetanusbakterien finden sich in Gartenerde, Straßenstaub oder im Sandkasten, Kinder sind damit also ständig konfrontiert. Über kleinste Verletzungen können sie in den Körper eindringen und Wundstarrkrampf hervorrufen. Selbst wenn die Erkrankung behandelt wird, sterben etwa 10 bis 20 % der betroffenen an Atemnot oder Herzversagen. Aufgrund der Impfung (in der Regel im Sechsfachimpfstoff) ist Wundstarrkrampf in Deutschland sehr selten.
- Keuchhusten (Pertussis). Die Keuchhustenerkrankung wird durch Bakterien übertragen und kann vor allem bei Säuglingen gefährlich Atemstillstände auslösen. In seltenen Fällen schädigen Sauerstoffmangel und Krampfanfälle das Gehirn, es drohen u. a. Lähmungen, Seh- und Hörstörungen. Geimpft wird im Rahmen der Sechsfach-Impfung.
- Kinderlähmung (Poliomyelitis). Polioviren sind überaus ansteckend, sie verbreiten sich über Husten und Niesen und über den Stuhl (Schmierinfektion). Bei den allermeisten Infizierten verläuft die Erkrankung unbemerkt. 4 bis 8% entwickeln jedoch grippeähnliche Symptome, bei bis zu 1 % von ihnen kommt es zu Lähmungen, die lebenslang anhalten können. Polio ist in Deutschland selten, kann aber durch Reisende ins Land gebracht werden. Umso wichtiger ist ein guter Impfschutz. Geimpft wird im Rahmen der Grundimmunisierung, bei Säuglingen meist mit der Sechsfach-Impfung.
- Hämophilus influenzae Typ B (Hib). Hib-Bakterien werden durch Husten und Niesen übertragen und infizieren vor allem den Nasenrachenraum inklusive Mittelohr und Nebenhöhlen. Bei schweren Verläufen kann der Kehldeckel anschwellen und zu Atemnot führen, auch Hirnhautentzündungen sind möglich. Säuglinge und Kleinkinder können innerhalb kurzer Zeit lebensbedrohlich erkranken. Die STIKO empfiehlt die Hib-Impfung ab einem Alter von 2 Monaten, sie ist in entsprechenden Sechsfach-Impfstoffen enthalten.
- Hepatitis B. Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus gefährden die Leber. Die Viren werden über Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen, insbesondere beim Geschlechtsverkehr. Die STIKO rät zu einer frühen Impfung im Rahmen der Grundimmunisierung. Dadurch werden Jugendliche rechtzeitig vor Beginn ihrer sexuellen Aktivität vor der Erkrankung geschützt. Die Hepatitis-B-Impfung kann gemeinsam im Sechsfach-Impfstoff verabreicht werden.
- Pneumokokken. Pneumokokken sind Bakterien, die durch Husten und Niesen übertragen werden und schwere Infektionen in Mittelohr, Lunge, und Nasennebenhöhlen verursachen. Auch Blutvergiftung (Sepsis) und Hirnhautentzündungen gehen auf ihr Konto. Die Infektion variiert stark. Es gibt Keimträger*innen, die völlig krankheitsfrei sind, bei anderen kommt es zu schweren Verläufen, von denen jede zehnte tödlich endet. Die Pneumokokkenimpfung wird zu den gleichen Zeitpunkten verabreicht wie die anderen Grundimmunisierungen, allerdings in einer separaten Spritze.
- Meningokokken B. Von diesen Bakterien, die zu Hirnhautentzündung und Blutvergiftung führen können, gibt es verschiedene Typen. Sie alle werden durch Tröpfchen übertragen. Eine von zwölf Erkrankungen mit Meningokokken Typ B verläuft tödlich. Bei den Überlebenden sind Langzeitfolgen wie Hörverlust oder Nierenschäden möglich. Die STIKO empfiehlt die Meningokokken-B-Impfung im Rahmen der Grundimmunisierung. Ebenso wie die Pneumokokkenimpfung erfolgt sie in einer separaten Spritze.
Masern, Mumps, Röteln und Windpocken
Auch Masern, Mumps und Röteln sind alles andere als harmlos, weshalb Kinder dagegen geimpft werden sollten. Im Gegensatz zu Impfstoffen der Grundimmunisierung handelt es sich um Lebendimpfstoffe. Sie enthalten abgeschwächte Erreger, die sich nur leicht vermehren und keine volle Krankheit auslösen. Milde Beschwerden wie leichter Ausschlag, erhöhte Temperatur, Gelenkbeschwerden oder leichte Durchfälle treten bei 2 bis 10 % der Geimpften auf und klingen nach wenigen Tagen wieder ab. Lebendimpfstoffe sollen erst ab dem 11. Monat geimpft werden, da das kindliche Immunsystem erst ab diesem Zeitpunkt reif dafür ist. Meist werden Masern, Mumps und Röteln zusammen in einem Kombiimpfstoff (MMR-Impfung) geimpft. Die richtigen Zeitpunkte dafür sind das Alter von 11 sowie von 15 Monaten.
- Masern. Masernviren sind extrem ansteckend, sie rufen grippeähnliche Symptome und Hautausschlag hervor. Eine von 1000 Erkrankten entwickelt eine Gehirnentzündung, die in bis zu 20% tödlich verläuft. Bei einem Drittel der Betroffenen mit Gehirnentzündung bleiben Schäden zurück. Bei 30 bis 60 von 100 000 erkrankten Kindern unter 5 Jahren kommt es zu einer schwerwiegenden Spätfolge, der subakuten sklerosierenden Panenzephalitis. Dabei handelt es sich um einen schleichenden Zerfall des Gehirns bis zum Tod. Um diese schweren Folgen zu verhindern, wird gegen Masern geimpft. Gemäß Masernschutzgesetz müssen alle Kinder beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten eine Impfung oder eine Masernimmunität nachweisen. Da ein Lebendimpfstoff verwendet wird, kann es zu milden Symptomen kommen (siehe oben). Die Wahrscheinlichkeit für eine Gehirnentzündung ist entgegen der Propaganda von Impfgegner*innen verschwindend gering, sie beträgt weniger als 1 Fall pro 1 Million Geimpften (im Vergleich 1:1000 bei Masernerkrankung).
- Mumps. Mumpsviren werden durch Tröpfchen oder Speichel übertragen und lösen bei zwei Drittel der Infizierten Fieber, Kopf- und Ohrenschmerzen aus. Oft schwellen beide Ohrspeicheldrüsen an. In einem von 100 Erkrankungsfällen kann es zu einer Gehirnentzündung kommen, ältere an Mumps erkrankte Jungen entwickeln öfter eine Hoden- oder Nebenhodenentzündung. Auch Entzündungen der Hörnerven können auftreten und zu bleibenden Hörschäden führen. Gegen Mumps wird wie gegen Masern zweimal geimpft, meist mit dem MMR-Kombiimpfstoff.
- Röteln. Rötelnviren werden ebenfalls durch Tröpfchen übertragen und lösen eine erkältungsähnliche Erkrankung mit Hautausschlag und Fieber aus. Komplikationen sind selten, sie treffen die Atemwege, das Mittelohr, die Hirnhäute und das Herz. Besonders gefährlich sind Röteln, wenn sich eine ungeschützte Schwangere ansteckt. Dann droht dem Kind die Röteln-Embryopathie mit schweren Fehlbildungen an Ohr, Auge, Herz und Gehirn. Zum eigenen Schutz, aber auch um die Verbreitung zu verringern, sollten Kinder im Alter von 11 und 15 Monaten gegen Röteln geimpft werden.
Hinweis. Eine weitere Impfung ab 11 bis 12 Monate ist die gegen Windpocken (zwei Impfungen). Die bisher empfohlene Impfung gegen Meningokokken C entfällt, stattdessen soll im Jugendalter ein zweites Mal gegen Meningokokken geimpft werden.
Impfungen für Kinder ab 9 Jahren
Seit 2007 empfiehlt die STIKO die Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) für Mädchen, seit 2018 auch für Jungen. HPV werden beim Geschlechtsverkehr übertragen und können Krebs verursachen, vor allem am Gebärmutterhals, aber auch am After, am Penis und im Rachen. Besonders gefährlich sind HPV 16 und 18. Gegen eine Ansteckung mit diesen beiden (je nach Präparat auch weiteren) Typen schützt die HPV-Impfung. Geimpft wird im Zeitraum zwischen 9 und 14 Jahren. Für den besten Schutz ist es wichtig, dass die Impfung vor dem ersten Sexualkontakt erfolgt. Seit ihrer Einführung hat sich gezeigt, dass die Impfung sicher und effektiv ist. In Schweden ist das Auftreten von Gebärmutterhalskrebs bei geimpften Frauen um 90% gesunken.
Seit 2025 sollen laut STIKO 12- bis 14-Jährige eine weitere Impfung erhalten: die Meningokokkenimpfung gegen die Typen A, C, W und Y, die sogenannte MenACWY-Impfung. Die STIKO verfolgt dadurch zwei Strategien. Jugendliche sind die Altersgruppe, deren Rachenbereich am stärksten mit Meningokokken besiedelt ist (wobei die meisten Träger keine Symptome zeigen). Durch Partys, Schule und Gruppenaktivitäten werden die Bakterien leicht verbreitet. Die Impfung schützt nicht nur die Jugendlichen selbst vor einer schweren Erkrankung. Sie reduziert auch die Anzahl an Übertragenden und senkt dadurch die Infektionsrate insgesamt.
Hinweis: Im Jugendalter ist es wichtig, auch an die Auffrischimpfung der Grundimmunisierung zu denken. Dazu gehören die Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Poliomyelitis (DTP-M-Impfung). Ein guter Termin dafür ist die U11 oder die J1. Die DTP-M-Auffrischung kann beim gleichen Termin wie die MMR-Impfung verabreicht werden, sie stören sich gegenseitig nicht.
Wie sieht es mit Grippe und Corona aus?
Eine Impfung gegen Corona oder die Influenza (Grippe) wird von der STIKO für Kinder derzeit (2025) nicht standardmäßig empfohlen. Möglich sind beide Impfungen ab dem Alter von sechs Monaten. Ratsam ist die Grippeimpfung bei chronisch kranken Kindern, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das sind z. B. Kinder mit
- chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma
- Herz-Kreislauf-, Leber- oder Nierenerkrankungen
- Diabetes
- neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder
- angeborenen bzw. erworbenen Immuninfekten oder einer HIV-Infektion.
Kinder mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege und Abwehrschwäche sollten zudem gegen Coronaviren geimpft werden. Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche, die in Pflegeeinrichtungen betreut werden – denn dort haben sie ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren. Die Basisimmunität gegen Coronaviren ist bei drei Kontakten mit dem Virus oder seinen Bestandteilen (Impfung) erreicht.
Quellen: STIKO, DKFZ, Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit
weiterlesen weniger

Was bei Nackenschmerzen hilft
Medikamente, Wärme oder Schonen?-
Fast die Hälfte der Erwachsenen betroffen
Nackenschmerzen treten im Bereich der Halswirbelsäule zwischen Schädelbasis und den oberen Schulterblättern auf. Manchmal ziehen sie auch in die Schultern, den unteren Hinterkopf und den oberen Rücken. Der Schmerz ist dabei dumpf, drückend und ziehend und kann bei Bewegungen schlimmer werden. Häufig fühlt sich der Nacken auch steif an und das Drehen des Kopfes fällt schwer. Berührt man den schmerzenden Bereich oder versucht ihn zu massieren, lassen sich oft harte, verspannte Muskeln tasten.
Je nach ihrer Dauer werden Nackenschmerzen eingeteilt in
- akut: bis zu drei Wochen
- subakut: vier bis zwölf Wochen oder
- chronisch: länger als zwölf Wochen.
Die Abgrenzung fällt allerdings manchmal schwer, da der Beginn oft nicht genau definiert werden kann.
Fast die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland gibt an, in den letzten Monaten mindestens ein Mal Nackenschmerzen gehabt zu haben – sie kommen also sehr oft vor. In der Hausarztpraxis gehören sie sogar zum dritthäufigsten Beratungsanlass. Frauen sind davon etwas häufiger betroffen als Männer, bei Menschen über 70 Jahren werden sie etwas seltener.
Hinweis: Auch Kinder und Jugendliche leiden unter Nackenschmerzen. Tendenziell soll die Anzahl der Betroffenen zwischen 3 und 17 Jahren steigen. Als Ursache gelten u.a. Bewegungsmangel und die immer längere Smartphonenutzung.
Wo kommen Nackenschmerzen her?
In den meisten Fällen von Nackenschmerzen lassen sich keine strukturellen Ursachen wie sichtbare oder messbare Probleme an den Knochen, Gelenken oder Nerven nachweisen. Dann spricht man von unspezifischen Nackenschmerzen. Als häufigster Grund für akute unspezifische Nackenschmerzen gelten Muskelverspannungen, z. B. ausgelöst durch lange Computerarbeit, Zugluft oder eine ungünstige Schlafhaltung. Sie klingen in der Regel auch ohne Behandlung innerhalb von ein bis zwei Wochen ab.
Halten die Beschwerden länger als drei Monate an, stecken hinter unspezifischen Nackenschmerzen oft Belastungen und Stress. Fehlhaltungen und Bewegungsmangel tragen zu ihrer Entwicklung zusätzlich bei.
Zu den seltenen strukturellen (spezifischen) Ursachen von Nackenschmerzen gehören z. B. arthrotische Veränderungen oder Rheuma. In weniger als 1% der Fälle gehen Nackenschmerzen auf eine gefährliche Ursache zurück. Dazu gehören Bandscheibenvorfall, Tumoren, Osteoporose mit Wirbelbrüchen, Nervenerkrankungen oder Infektionen.
Nackenschmerzen abklären lassen
Wer nach einer schlechten Nacht oder einer langen Gaming-Sitzung unter Nackenschmerzen leidet, benötigt meist keine ärztliche Hilfe. Es gibt jedoch auch Nackenschmerzen, die man bei der Hausärzt*in abklären lassen sollte. Das gilt zum einen, wenn die Schmerzen über eine längere Zeit anhalten. Denn auch wenn nichts Gefährliches dahinter steckt, ist es sinnvoll, eine gezielte Behandlung einzuleiten.
In manchen Fällen muss immer rasch eine ärztliche Abklärung erfolgen. Warnzeichen für eine der seltenen, gefährlichen Ursachen von Nackenschmerzen sind
- Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Lähmungen von Armen und Beinen
- starke Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteife und Übelkeit
- unerklärter Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß
- Nackenschmerzen nach einem Sturz oder Unfall
- gleichzeitige Schluckbeschwerden oder Schmerzen im Brustkorb
Diese Beschwerden können z. B. auf einen Bandscheibenvorfall, einen Tumor oder eine Meningitis hindeuten.
Wie sieht die Diagnostik bei Nackenschmerzen aus?
Bei neu aufgetretenen Nackenschmerzen befragt die Ärzt*in die Patient*in zunächst ausführlich, wie stark die Beschwerden sind, wann sie auftreten und wie lange sie schon bestehen. Zusätzlich wird nach eigenen Behandlungsversuchen und deren Erfolg/Misserfolg gefragt, ebenso nach der Lebenssituation, mit besonderem Schwerpunkt auf Belastungen und Stress.
Wichtig sind auch vorangegangene Infektionen, Stürze oder Unfälle und begleitende Erkrankungen. Auch die Medikamenteneinnahme ist von Bedeutung: So begünstigt z. B. die langfristige Einnahme von Kortison eine Osteoporose, die sich an der Halswirbelsäule bemerkbar machen kann. Abgefragt werden auch immer die sogenannten B-Symptome Nachtschweiß, Gewichtsverlust und Leistungsknick. Diese können auf eine Tumorerkrankung hinweisen.
Nach der Erhebung der Krankengeschichte wird die Patient*in körperlich untersucht. Dabei prüft die Ärzt*in die Beweglichkeit der Halswirbelsäule und ob die Dornfortsätze (die Erhebungen entlang der Wirbelsäule) druckschmerzhaft sind. Meist tastet sie auch die Muskulatur ab und sucht nach Verspannungen und Verhärtungen.
Um die Beteiligung von Nerven auszuschließen, wird eine kurze neurologische Untersuchung durchgeführt. Dazu gehört u.a. die Prüfung von Kraft, Feinmotorik und Sensibilität (Gefühl) der Finger, meist werden auch das Gangbild und die Reflexe getestet.
In den allermeisten Fällen kann die Ärzt*in nach dieser ausführlichen Anamnese und Untersuchung eine strukturelle Ursache der akuten Nackenschmerzen ausschließen und die Diagnose „unspezifische Nackenschmerzen“ stellen. Eine weitere Diagnostik ist nur erforderlich, wenn entsprechende Hinweise gefunden wurden.
Mehr Diagnostik wird auch empfohlen, wenn die Nackenschmerzen trotz Behandlung länger als vier bis sechs Wochen anhalten und die Betroffenen sehr in ihren Aktivitäten einschränken. Dies kann ein Hinweis auf eine initial nicht erkannte spezifische Ursache sein.
Zu den weiteren Untersuchungen gehört vor allem die Bildgebung. Zu bevorzugen sind die CT und die MRT, da sich mit diesen Untersuchungsverfahren Frakturen, Tumoren, Infektionen und Neuropathien besser erkennen lassen als mit dem konventionellen Röntgen. Bei einem Verdacht auf Infektionen oder Tumoren kommen entsprechende Laboruntersuchungen zum Einsatz. Für diese Spezialuntersuchungen und zur Weiterbehandlung überweist die Hausärzt*in die Patient*in meist in eine entsprechende Facharztpraxis (Rheumatologie, Neurologie, Orthopädie).
Hinweis: Bildgebende Verfahren sind bei unspezifischen Nackenschmerzen in den allermeisten Fällen nicht erforderlich. Sie können sogar schaden, da darin oft Veränderungen in der HWS erkannt werden, die nicht Ursache der Schmerzen sind. Das kann unbegründete Ängste wecken, die Betroffenen unnötig belasten und manchmal sogar überflüssige Therapien nach sich ziehen.
Bewegung ist das A und O
Für das Selbstmanagement bei unspezifischen Nackenschmerzen gibt es einige nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Dazu gehören körperliche Aktivität, Wärme- oder Kältebehandlungen und Entspannungsübungen.
- Körperliche Aktivität: Betroffene mit unspezifischen Nackenschmerzen sollten sich bewegen, also körperlich aktiv bleiben. Wenn nötig, auch mithilfe einer medikamentösen Schmerztherapie (siehe unten). Sinnvoll sind auch leichte Übungen, z. B. die Halsmuskulatur anzuspannen und in sanfter Dehnung zu entspannen. Die Expert*innen der aktuellen Leitlinie zum unspezifischen Nackenschmerz empfehlen dazu ein Video-Beispiel auf youtube (https://www.youtube.com/watch?v=6-bu6N-emq4, vierte Übung). Weitere Übungen sind Schulterkreisen, Kopfneigen, Seitdehnung und Kinn-zur-Brust, alles natürlich sanft und schonend.
- Wärme oder Kälte: Wärme kann bei unspezifischen Nackenschmerzen die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit bessern. Insgesamt gibt es dazu allerdings kaum Daten aus Studien, die Empfehlungen beruhen auf Expertenwissen. Empfohlen werden dafür z. B. aufgewärmte Körnerkissen. Auch Wärmepflaster oder eine heiße Rolle können hilfreich sein. Manche Betroffenen profitieren statt von Wärme eher von Kälteanwendungen. Sofern dies als schmerzlindernd empfunden wird, raten Expert*innen nicht davon ab.
- Entspannungsverfahren: Für den Effekt von Entspannungsverfahren wie der Progressiven Muskelrelaxation gibt es unterschiedliche Ergebnisse. In einigen Studien wurden Schmerzen und Beweglichkeit gebessert, in anderen nicht. Möglicherweise helfen Entspannungsverfahren aber dabei, das Stresserleben zu reduzieren und der Entwicklung chronischer Nackenschmerzen entgegenzuwirken.
Hinweis: Den Hals mit einer Halskrause oder einer Nackenschiene ruhig zu stellen wird bei unspezifischen Nackenschmerzen nicht empfohlen. Expert*innen gehen davon aus, dass dies eher schädlich wirkt: Einerseits bildet sich die Halsmuskulatur zurück, andererseits wird die Passivität der Betroffenen gefördert.
Medikamentöse Hilfe bei Nackenschmerzen
In manchen Fällen sind bei unspezifischen Nackenschmerzen Schmerzmittel erforderlich. Eine Schmerztherapie kann auch dazu dienen, beweglich und aktiv zu bleiben. In Frage kommen, wenn erforderlich, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und Metamizol.
- NSAR. Am häufigsten werden NSAR wie Ibuprofen, Diclofenac oder Naproxen eingesetzt. Ihr Effekt wird in Studien unterschiedlich bewertet. Zudem haben sie ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen, insbesondere auf die Magenschleimhaut. Sie erhöhen auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insgesamt gilt, dass sie so niedrig dosiert und so kurz wie möglich eingesetzt werden sollten. Für chronische unspezifische Nackenschmerzen werden sie aufgrund der genannten Nebenwirkungen nicht empfohlen.
- Metamizol. Für Patient*innen, die NSAR nicht vertragen oder ein zu hohes Risiko für die genannten Nebenwirkungen haben, stellt Metamizol eine Alternative dar. Dieses Präparat kann allerdings in sehr seltenen Fällen bestimmte Zellen im Blut verringern (Agranulozytose). Bei längerer Einnahme sollte deshalb regelmäßig das Blutbild kontrolliert werden. Außerdem müssen die Patient*innen die typischen Symptome Fieber, Halsschmerzen und Schleimhautläsionen kennen und bei deren Auftreten die Hausärzt*in aufsuchen.
Von anderen Schmerzmitteln wie Paracetamol und Opioiden rät die Leitlinie ab. Paracetamol soll aufgrund seiner mangelnden Wirkung auf Nackenschmerzen nicht genommen werden, Opioide aufgrund ihrer unerwünschten Wirkungen und ihres Suchtpotenzials.
Verschreibungspflichtige muskelrelaxierende (entspannende) Wirkstoffe werden bei unspezifischen Nackenschmerzen auch gerne angewendet. Allerdings ist ihre Wirkung in Studien kaum belegt. Bei akuten unspezifischen Nackenschmerzen mit starker Verspannung sind sie eine Behandlungsoption, wenn NSAR nicht anschlagen. Aufgrund ihrer möglichen Nebenwirkungen wie Blutbildstörungen, Schwindel oder zentraler Sedierung (Dämpfung) sollten sie allerdings nicht länger als zwei Wochen angewendet werden.
Hinweis: Für die Wirkung pflanzlicher Schmerzmittel wie Weidenrinde und Teufelskralle gibt es keine aussagekräftigen Studien. Ihr Einsatz wird deshalb in den Leitlinien nicht bewertet.
Chirotherapie, Akupunktur und Laser
Bei unspezifischen Nackenschmerzen werden auch häufig nicht-medikamentöse Verfahren und Methoden angeboten. Einige werden eher kritisch betrachtet, da ihre Wirkung nicht ausreichend belegt ist. Dazu kommt, dass viele der eingesetzten Methoden die Passivität der Betroffenen fördern. Dies steht im Widerspruch zu der Erkenntnis, dass körperliche Bewegung die Basis bei der Behandlung von unspezifischen Nackenschmerzen ist.
Grünes Licht geben die Expert*innen für die manuelle Therapie (Chirotherapie). Aktuellen Studien zufolge kann diese Technik bei akuten unspezifischen Nackenschmerzen die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit der Halswirbelsäule bessern. Voraussetzung für eine Verordnung ist, dass keine Kontraindikationen wie Osteoporose, Schäden an der Wirbelsäule oder Gefäßkrankheiten vorliegen.
Die Akupunktur zeigt bei länger bestehenden unspezifischen Nackenschmerzen kleine bis mittlere Effekte. Insbesondere wenn andere Maßnahmen nicht greifen, kann sie versucht werden. Sie sollte aber – ebenso wie die Chirotherapie – mit aktivierenden Maßnahmen kombiniert werden.
Keinen Wirknachweis in kontrollierten Studien brachte die Behandlung mit Laser, Interferenzstrom oder Ultraschall. Gleiches gilt für die Behandlung mit medizinischen Bädern und Rotlicht, die deshalb nicht auf Kassenkosten verordnet werden sollten.
Auch Kinesiotapes werden manchmal bei akuten Nackenschmerzen eingesetzt. Eine Wirkung konnte allerdings bisher nicht belegt werden, zumal drohen allergische Reaktionen. Die Leitlinienautor*innen raten deshalb davon ab.
Hinweis: Bei chronischen unspezifischen Nackenschmerzen hat sich die kognitive Verhaltenstherapie als wirksam erwiesen. Sie kann Schmerzen, Angst vor Bewegung, Depressivität und allgemeine Ängstlichkeit bessern und wird vor allem im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzepts empfohlen.
Quelle: S3-Leitlinie „Nicht-spezifische Nackenschmerzen“, AWMF-Register-Nr. 053-007 DEGAM-Leitlinie Nr. 13, Version 3.0, gültig bis 17.02.2030
weiterlesen weniger

Was hilft Erwachsenen mit ADHS?
Probleme im Alltag und im Beruf-
Bis zu 5% der Erwachsenen betroffenen
Die Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist schon lange bekannt, tauchte aber zunächst unter anderen Namen auf. Zum Beispiel im 1845 erschienenen Kinderbuchbuch „Der Struwwelpeter“: Darin spiegelten der Zappelphilipp die motorische Unruhe und Hanns-Guck-in-die Luft die Unaufmerksamkeit. Wenige Jahre danach beschäftigten sich die ersten Kinderärzt*innen mit dem Syndrom, verknüpften es allerdings fälschlicherweise mit einer Intelligenzminderung. Schließlich ordnete 1902 ein britischer Arzt die Erkrankung wissenschaftlich ein: Er beschrieb Kinder mit ausgeprägter Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität bei sonst normaler Intelligenz.
In den 1980er-Jahren stellte sich mehr und mehr heraus, dass auch Erwachsene unter ADHS-Symptomen leiden können. Heute gilt ADHS als eine neurodiverse Entwicklung, die bestimmte Stärken und Herausforderungen mit sich bringen kann und deren Auswirkungen stark von Umgebung und Unterstützung abhängen. Fast immer beginnt ADHS im Kindesalter und bleibt bei vielen Betroffenen bis ins Erwachsenenalter bestehen.
In Deutschland haben etwa 5-10 % der Kinder und Jugendlichen ADHS, und etwa 60 % nehmen die Störung ins Erwachsenenalter mit. Das führt dazu, dass 2-5 % der Erwachsenen in Deutschland davon betroffen sind. Manchmal kommt es auch erst im Erwachsenenalter zur Diagnose, z. B. wenn die ADHS-Symptome zu Problemen im Arbeitsleben oder in Beziehungen führen. Dann ist die Störung jedoch nicht neu entstanden. Stattdessen wurden die entsprechenden Verhaltensweisen im Kindesalter nicht richtig gedeutet oder übersehen.
Hinweis: Bei den Kindern und Jugendlichen leiden überwiegend Jungen an ADHS. Im Erwachsenalter ist das anders: Hier sind Frauen und Männer etwa gleich häufig betroffen.
Aktivierungsmuster im Gehirn verändert
ADHS beruht wahrscheinlich auf neurobiologischen Veränderungen in bestimmten Hirnregionen. Neuere Studien legen nahe, dass bei ADHS bestimmte Hirnnetzwerke — besonders zwischen tief liegenden Strukturen und dem Frontallappen — anders miteinander verbunden sind als gewöhnlich. Auch die Aktivierungsmuster im Gehirn unterscheiden sich, betroffen ist dabei u.a. der Botenstoff Dopamin. Warum es zu diesen Veränderungen kommt, ist noch nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die vor, während und kurz nach der Geburt auf das Gehirn des Kindes einwirken.
Da ADHS gehäuft in Familien vorkommt, ist eine genetische Beteiligung wahrscheinlich. Die Veranlagung kann also vererbt werden, wobei nicht ein einzelnes, sondern eine Vielzahl von Genen daran beteiligt sind. Hinzu kommen äußere Einflüsse. Rauchen in der Schwangerschaft soll das Risiko für ADHS beim Kind erhöhen, Gleiches gilt für Alkohol. Weitere Risikofaktoren sind Frühgeburt und ein geringes Geburtsgewicht. Auch belastende frühe Lebensumstände werden als mögliche Faktoren diskutiert. Diese Einflüsse wirken jedoch stets gemeinsam mit genetischen und anderen Umweltfaktoren und sind für sich allein weder Ursache noch Garantie für die Entwicklung von ADHS.
Hinweis: Lange wurde diskutiert, ob eine zuckerreiche Ernährung oder die Einnahme von Acetylsalicylsäure (Aspirin) ADHS auslösen könnten. Das ist inzwischen ebenso widerlegt wie die Annahme, dass eine strenge Erziehung dazu führt.
Innere Unruhe und Probleme im Alltag
ADHS beruht bei Kindern und Erwachsenen auf den gleichen Veränderungen im Gehirn. Hyperaktivität, gestörte Aufmerksamkeit und Impulsivität äußern sich nur etwas unterschiedlich. Die bei Kindern oft überaus starke motorische Aktivität verlagert sich bei Erwachsenen häufig nach innen.
Insgesamt variieren die ADHS-Symptome auch bei Erwachsenen sehr. Nicht bei allen sind die Symptome gleich stark ausgeprägt und entsprechend unterschiedlich beeinflussen sie das Leben der Betroffenen.
- Aufmerksamkeitstörungen führen dazu, sich nur kurz auf eine Sache konzentrieren zu können. Typisch sind sprunghaftes Denken, leichte Ablenkbarkeit und viele Flüchtigkeitsfehler. In manchen Fällen kommt es auch zur sogenannten Hyperkonzentration. Das bedeutet, dass eine Person sich über einen längeren Zeitraum extrem intensiv auf eine bestimmte Tätigkeit oder ein Thema konzentrieren kann – oft so sehr, dass die Umgebung und die Zeit ausgeblendet werden.
- Innere Unruhe und Überaktivität äußern sich bei Erwachsenen eher weniger durch Herumrennen und Herumhüpfen. Stattdessen überwiegen eine starke innere Anspannung, Nervosität und Fingertrommeln oder Fußwippen.
- Eine verstärkte Impulsivität zeigt sich nicht nur in spontanen Entscheidungen und vermehrtem unüberlegtem Handeln. Typisch ist auch ein verstärkter Redefluss, die Tendenz, andere zu unterbrechen und schnelle Stimmungswechsel.
Für ADHS-Betroffene ist es oft problematisch, die eigenen Gefühle zu kontrollieren. Die geringe Frustrationstoleranz führt dazu, dass Misserfolge oder negative Gefühle schwer auszuhalten sind. Ihre Reizbarkeit ist hoch, manche sind besonders empfindlich gegenüber Zurückweisung oder Kritik. Betroffene berichten auch häufig, dass sie Schwierigkeiten haben, von einer negativen Stimmung in eine neutrale oder positive „umzuschalten“. Typisch sind auch ausgeprägte Schamgefühle nach emotionalen Ausbrüchen. Diese emotionale Dysregulation hat aber auch eine positive Seite: Sie geht oft mit ausgeprägter Empathie, Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und emotionaler Lebendigkeit einher.
All diese Reaktionen und Verarbeitungsweisen können den Alltag von Menschen mit ADHS manchmal herausfordernder machen. Viele erleben, dass es ihnen schwerfällt, Zeit und Aufgaben zu strukturieren oder Prioritäten zu setzen – besonders in Situationen mit hoher Belastung oder vielen Anforderungen. Dadurch kann es zu vergessenen Terminen oder verlegten Dingen kommen, und die Umgebung wirkt mitunter unübersichtlich. Solche Situationen können gelegentlich zu Missverständnissen oder Spannungen mit Angehörigen, Freund*innen oder Kolleg*innen führen.
Hinweis: Manche Menschen nutzen ihre ADHS-typischen Eigenschaften wie z. B. verstärkte Kreativität oder Spontaneität auch positiv. Besonders in der Musikszene und im Filmgeschäft gibt es dafür Beispiele.
Ist es ADHS?
Ein Großteil der ADHS-betroffenen Erwachsenen kennt ihre Diagnose seit der Kinder- und Jugendzeit. Bei ihnen gilt es, die Behandlung von der Kinder- und Jugendpsychiater*in zur Erwachsenenpsychiater*in zu überführen. Manche Männer und Frauen leiden jedoch seit ihrer Kindheit unter ADHS-Symptomen, ohne dass diese richtig zugeordnet werden. Insbesondere Frauen schaffen es oft, ihre Probleme jahrelang zu kompensieren – was in vielen Fällen zu ausgeprägter Erschöpfung, Depressionen oder Angststörungen führt.. Doch in Zeiten, in denen neuer oder verstärkter Druck ins Leben kommt, gelingt das meist immer schlechter. Dazu gehören Prüfungen, der Übergang ins Arbeitsleben oder veränderte soziale Strukturen wie eine festen Beziehung. Dann stellt sich manchen die Frage, ob ihre Beschwerden noch „normal“ sind oder auf einer ADHS beruhen – dies gilt umso mehr, seit ADHS vermehrt in den Medien thematisiert wird.
Im Internet gibt es eine Reihe von ADHS-Tests, die bei einem Verdacht helfen können. Eine Diagnose kann man damit nicht stellen, dafür ist eine ärztliche Untersuchung erforderlich. Wer unter starkem Leidensdruck steht und bei sich ADHS vermutet, sollte deshalb versuchen, dies bei einer Psychiater*in oder einer ärztlichen Psychotherapeut*in abklären zu lassen. Aufgrund der begrenzten Anzahl spezialisierter Anlaufstellen kommt es oft zu langen Wartezeiten. Selbsthilfegruppen können die Betroffenen in dieser Zeit unterstützen.
Für die Diagnose ADHS bei Erwachsenen gilt es zu prüfen, ob die Kriterien für Hyperaktivität, Impulsivität und/oder Unaufmerksamkeit erfüllt sind. Diese Kriterien sindin medizinischen Leitlinien festgelegt. Außerdem müssen die Beschwerden seit der Kindheit vorliegen, aktuell mindestens sechs Monate anhalten und berufliche und soziale Beeinträchtigungen verursachen.
Um das herauszufinden, führt die Ärzt*in ein ausführliches Gespräch mit der Patient*in. Dabei lässt sie sich nicht nur die aktuellen Symptome schildern, sie fragt auch nach Verhaltensauffälligkeiten in der Kindheit und im Jugendalter. Wichtige Werkzeuge dafür sind standardisierte Fragebogen wie die Connor´s Adult ADHD Rating SCALE (CAARS). Um die Treffsicherheit der Diagnose zu verbessern, hilft die Befragung von nahen Angehörigen – sofern die Patient*in damit einverstanden ist.
Viele der ADHS-Beschwerden ähneln den Symptomen bei Suchterkrankungen oder bei Persönlichkeitsstörungen. Die Ärzt*in muss deshalb genau unterscheiden, um welche Ursache es sich handelt. Erschwerend kommt hinzu, dass ADHS-Betroffene relativ häufig weitere neuropsychiatrische Erkrankungen aufweisen, etwa Angststörungen oder Depressionen.
Lebensstiländerung und Psychotherapie
Die Behandlung von ADHS erfolgt mit Psychotherapie und Medikamenten. Insbesondere bei leichter Problematik sind Lifestylemodifikationen und eine Verhaltenstherapie hilfreich. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, kommen Medikamente hinzu. Unterstützend bei einer ADHS-Behandlung ist regelmäßiger Sport. Dabei werden Botenstoffe wie Dopamin und Noradrenalin freigesetzt, die positiv auf neurobiologische Prozesse im Gehirn wirken. Außerdem bessert Sport die Impulskontrolle und reduziert Stress und innere Unruhe. Daneben ist es wichtig, ausreichend zu schlafen.
Die ständige Flut an Informationen und schnellen Reizen durch digitale Medien kann die Aufmerksamkeit zerstreuen und dadurch ADHS-Symptome verstärken. Menschen mit ADHS sollten deshalb ihre Bildschirmzeit regulieren. Das gilt umso mehr, als dass ADHS-Betroffene besonders leicht internetsüchtig werden. Der Grund hierfür ist die schnelle Belohnung im Gehirn (Dopaminausschüttung) bei Nutzung digitaler Medien. Weil der Dopaminhaushalt bei ADHS oft gestört ist, wird die Dopaminausschüttung besonders intensiv erlebt.
Neben diesen Lebensstilanpassungen sind psychotherapeutische Verfahren ein unverzichtbarer Bestandteil der Behandlung. Besonders wirksam ist die kognitive Verhaltenstherapie. Studien haben gezeigt, dass sie das Zeitmanagement, die Bewältigung des Alltags und das Wohlbefinden deutlich verbessern kann. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt ist die sogenannte Psychoedukation. Die Patient*innen sollen die Erkrankung besser verstehen und akzeptieren, um dadurch besser mit ihr umgehen zu können.
- Für ein besseres Zeitmanagement und eine bessere Organisation im Alltag dienen Strukturierungsstrategien wie Prioritätenlisten, Mindmapping und eine strikte Kalenderführung. Bei der Pomodoro-Technik wird die Arbeit in 25-Minuten-Intervalle eingeteilt, die Salamitaktik bedeutet das schrittweise Zerlegen von Aufgaben in Teilaufgaben. Beides hilft ADHS-Betroffenen, ihren beruflichen und familiären Alltag besser zu bewältigen.
- Mittels Impulskontrollübungen sollen Betroffene lernen, besser mit emotional herausfordernden Situationen umzugehen. Dabei helfen der innere Dialog und die Neurofeedbacktherapie, bei denen die Selbststeuerung gefördert wird. Dazu kommen Kommunikations- und Konfliktmanagementtraining und das Erlernen von Meditation und Atemübungen.
- Gegen die innere Unruhe empfehlen Expert*innen neben regelmäßigem Sport auch spezielle Bewegungstherapien (z. B. Yoga) und Entspannungsverfahren. Besonders empfehlenswert ist die Gruppentherapie. Unter Mitbetroffenen kann man Strategien gegen verstärkte Impulsivität oder Gefühlsstörungen erproben. Darüber hinaus hilft die Gruppe, das Gefühl der Isolation zu durchbrechen. Verbessert wird die Lebensqualität auch durch den Erfahrungsaustausch mit Selbsthilfegruppen.
Menschen mit ADHS können zudem Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben beantragen, z. B. Jobcoaching, berufliche Reha-Vorbereitungsprogramme oder Umschulungen. Wird ADHS als Behinderung anerkannt, ist ein Nachteilsausgleich möglich (technische Hilfsmittels, besserer Kündigungsschutz, Anpassungen des Arbeitsplatzes).
Tipp: Auch digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA) für ADHS können helfen. Mit Tagebuchfunktionen, ADHS-Tipps und fundiertem ADHS-Wissen unterstützen sie Betroffene, mehr Ordnung in ihrem Kopf und ihrem Leben zu schaffen. Bei Verordnung durch eine Ärzt*in übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.
Medikamente gegen ADH
Wenn die nicht-medikamentösen Maßnahmen nicht ausreichen, den Leidensdruck zu lindern, kommen Medikamente ins Spiel. Je nach Schweregrad und Präferenz werden sie auch frühzeitig begleitend zu Lebensstilveränderungen und Verhaltenstherapie verordnet. Als Substanzen erster Wahl gelten laut Leitlinie Stimulanzien wie Methylphenidat und Amphetamine (Lisdexamfetamin). Sie verbessern vor allem die Aufmerksamkeit und die Impulskontrolle. Werden diese Medikamente nicht vertragen oder besteht gleichzeitig eine Suchterkrankung, ist das nicht-stimulierende Atomoxetin eine Option. Es gibt mehrere Krankheiten, bei denen die beiden stimulierenden Medikamente nicht eingenommen werden, zum Beispiel bei Schilddrüsenüberfunktion. Von einer Selbstmedikation ist also in jedem Fall abzuraten.
Außerdem ist es wichtig, die Medikation regelmäßig ärztlich kontrollieren zu lassen. Dabei wird geprüft, ob das Medikament wirksam ist oder evtl. in der Dosierung gesteigert werden sollte. Wichtig ist auch, Nebenwirkungen abzufragen und frühzeitig zu erkennen. Je nach Stabilität und Lebensumständen empfehlen die Leitlinien regelmäßige Absetzversuche unter ärztlicher Betreuung. Damit lässt sich erkennen, ob das Medikament noch erforderlich ist oder ob es auch ohne geht.
- Methylphenidat und Lisdexamfetamin können zu Appetitverlust, Schlafstörungen, Nervosität, Herzrasen und erhöhtem Blutdruck führen.
- Bei Atomoxetin dauert es bis zu sechs Wochen, bis das Medikament seine Wirkung entfaltet. Häufige Nebenwirkungen sind ebenfalls Appetitverlust und Schlafstörungen, aber auch Übelkeit, sexuelle Dysfunktion und depressive Verstimmung.
Hinweis: Koffein kann die Wirkung der stimulierenden Medikamente verstärken und dadurch das Risiko für Nervosität und Herzrasen erhöhen. Vor allem in der Anfangsphase der Medikamenteneinnahme sollte der Kaffeekonsum deshalb eingeschränkt werden.
Quellen: S3-Leitlinie ADHS, Springer Medizin
weiterlesen weniger